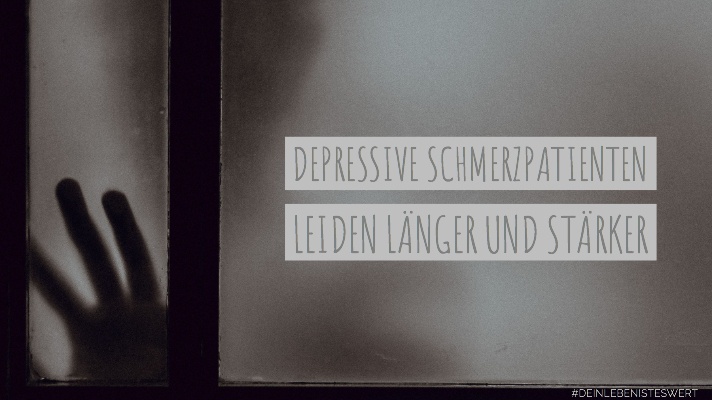
Depressive Schmerzpatienten leiden stärker und länger
Manuskript zum Workshop vom 29.09.2018 beim 1. Aachener Psychosomatik-Tag
„Sag Du es ihm, spricht die Seele zum Körper, auf mich hört er nicht“
Ziele einer psychosomatischen Schmerztherapie liegen im Erfassen von Stressfaktoren und deren Reduzierung durch Bearbeitung und gelingende intrapsychische Integration:
- Krisen, unverarbeitete Lebensereignisse und Traumata, die das Leben entscheidend beeinflusst haben, wie schwerwiegende Erkrankungen, Unfälle mit langfristigen erheblichen Beeinträchtigungen.
- Das Beziehungserleben bestimmende Veränderungen und Abschiede von wichtigen Menschen durch ungelöste Konflikte mit Kontaktabbruch, Trennung und Tod sowie Umzug.
- Ängste und Depressionen sowie Süchte
Wenn
- erfolgreiche Bearbeitung der Stressauslöser,
- Erlernen eines Stressmanagement mit geeigneten Entspannungsmethoden (z.B. Mindfullness based Stressregulation MBSR, Autogenes Training AT, Progressive Muskelrelaxation nach Jackobson PMR, Meditation, Yoga etc.)
- Stärkung der Selbstachtsamkeit mit verbessertem Krisenbewusstsein und -management und verbesserter Fähigkeit, sich abzugrenzen
- Steigerung der Selbstreflexionsfähigkeit
- eine Wiederbelebung des intimen Dialogs mit den engsten Bezugspersonen
gelingen, zeigt sich dies an einer verbesserten Schmerzverarbeitung mit meist einer geringeren Dosis von Analgetika, aber auch Antihypertensiva sowie geringeren allgemeinen Krankheitsanfälligkeit. Um das erreichen zu können, sind unter Umständen multimodale Behandlungsansätze, wie sie nur klinisch zu realisieren sind, mit anschließender ambulanter psychosomatischer Therapie erforderlich.
Klinisches Beispiel
Soll denn kein Angedenken
ich nehmen mit von hier?
Wenn meine Schmerzen schweigen
wer sagt mir dann von ihr?
(aus: Erstarrung. in Die Winterreise von Schubert)
Liebe und Tod, Eros und Tanatos, bilden das Spannungsfeld, das im Schmerz oft spürbar wird. Es für sich erträglich zu halten gelingt im achtsamen und liebevollen Miteinander leichter.
15 Jahre leidet der 74jährige Patient unter mal mehr, mal weniger starken Schmerzen in der rechten Hüfte. Zwischenzeitlich hatte er sich nur noch im Rollstuhl fortbewegen können. Wegen all der Schmerztabletten, die er hatte einnehmen müssen, hatte er zwischenzeitlich massive Magen- und Darmbeschwerden bekommen. Er war immer verzweifelter und hatte zuletzt kaum noch Lebensmut. Eine Vielzahl von körperlichen Untersuchungen und Therapieversuchen lagen hinter ihm. Manchmal hatte er nach einem neuen Therapieansatz und einer ersten Verbesserung die Hoffnung gehegt, dass endlich das Richtige gefunden worden sei. Doch schon nach kurzer Zeit kamen die Schmerzen wieder, und mit ihr all die Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit.
Der Verlust von Lebensfreude und Lebensqualität lässt die Menschen ihre Umwelt nur noch grau in grau erscheinen. Sie ziehen sich zunehmend aus dem Freundeskreis und zuletzt auch dem Familienleben zurück.
Seelischer und körperlicher Schmerz werden im gleichen Gehirnzentrum verarbeitet. Daher fällt es so schwer, die Ursache herauszufinden und das eine vom anderen zu trennen. Erst, wenn wir es gemeinsam betrachten, wir uns von dem Anspruch lösen, es einzig dem Körperlichen oder dem Seelischen zuzuschreiben, finden wir zu einer Gesamtschau auf den Schmerz.
Der Patient hatte mit 60 Jahren seine Arbeit verloren und wurde ein Jahr später berentet. Er war in leitender Position tätig gewesen und hatte schon länger vorausgesehen, dass der Betrieb es nicht mehr lange machen würde. Er dachte dabei an seine Mitarbeiter, hatte alles gegeben, um möglichst zu verhindern, dass es zur Insolvenz kam, hatte viele Überstunden gemacht und oft bis zur Erschöpfung gearbeitet. Darüber war die innere Anspannung angesichts der drohenden Entlassung immer stärker geworden.
Er hatte kaum mitbekommen, dass seine beiden Kinder zwischenzeitlich erwachsen geworden waren und er sogar schon Großvater geworden war. Seine Aufmerksamkeit hatte er fast ausschließlich auf seine Arbeit fokussiert gehabt. Ein Jahr nach der Berentung hatte er einen Herzinfarkt erlitten.
Leidvoll erinnerte er sich der schwierigen Jahre, die seine zwei Jahre jüngere Frau nach einer Brustkrebserkrankung im Alter von 55 Jahren durchgemacht hatte, an all ihre Ängste, die stets zugenommen hatten, wenn wieder eine Nachuntersuchung angestanden hatte. Er hatte eine schlechtes Gewissen, dass er ihr vielleicht nicht genügend zur Seite gestanden war. Es waren Schuldgefühle, die ihn innerlich permanent unter Spannung setzten.
Den Verlust der Arbeit erleben viele, vor allem sehr engagierte Menschen, als großen Stressfaktor. Der Verlust an Selbstaktualisierungsmöglichkeit durch eigene Tätigkeit, von Zugehörigkeit, Reputation und Gestaltungsmöglichkeit, vom vertrauten Tagesablauf und Wochenrhythmus wirkt tief und nachhaltig. Kontrolle und Orientierung im Leben sind gestört. Insbesondere Menschen, die wenig Selbstachtsamkeit gelernt haben, die ihre Aufmerksamkeit auf das Wohlbefinden anderer lenken und ihr eigenes Erleben, ihre eigenen Bedürfnisse nach Bindung und Beziehung nicht spüren können, sind gefährdet. Sie beherzigen oft auch ihr Bedürfnis nach Lust und Vermeiden von Unlust nicht ausreichend. Wenn dann noch die Möglichkeit, seinen Selbstwert durch beruflichen Erfolg zu stützen wegbricht, droht das innere Gleichgewicht zusammenzubrechen.
Selbstvertrauen kann ein Mensch wieder aufbauen, wenn er die Erfahrung macht, dass andere ihm vertrauen, ihm ehrliches Interesse für seine Lebenszusammenhänge entgegenbringen, er sich in seinem emotionalen Erleben angenommen erlebt.
Er kann so lernen, seine Bedürfnisse wahrzunehmen, für sie Worte zu finden, sie verständlich mitzuteilen und Möglichkeiten zu ihrer Befriedigung im Heute zu finden.
Der Patient war als kleines Kind von gerade sechs Jahren mit seiner Mutter und drei weiteren kleineren Geschwistern aus Ostpreußen geflohen. Unterwegs war er einmal böse auf seine rechte Hüfte gestürzt. Seine Mutter hatte ihn damals nicht wirklich trösten können. Zum gleichen Zeitpunkt hatte die Fliehenden die Nachricht vom Tod des Vaters erreicht. Sein Vater war für den Jungen das große Vorbild gewesen, das ihm immer vorgehalten worden war, und der ihm immer etwas mitgebracht hatte, wenn er auf Heimaturlaub gekommen war. Seine Mutter, so beschrieb der Patient, hatte schrecklich unter diesem Verlust gelitten. Lange hatte sie sich nicht davon erholt, hatte ihre Gefühle wie in einen Kokon eingeschlossen. Dann starb auch noch ihr jüngstes Kind an einer Lungenentzündung.
Sie hatten sich auf einem unbekannten Weg ins Nichts befunden, und sie wusste sofort, dass sie den Rest ihres Lebens als alleinerziehende Mutter von noch drei Kindern alle ihre Bedürfnisse zurückstellen und es vorrangig darum gehen musste, dass sie durchkamen. Für ihre Kinder war sie in ihrem Schmerz und ihrer Trauer, ihrer Überforderung emotional kaum erreichbar gewesen.
Er hatte als ältester Sohn versucht, den Vater zu ersetzen. Die Liebe, die er von ihr nicht hatte bekommen können, ihr zu geben. Er wurde ein guter Schüler, half der Mutter im Garten, besorgte zu essen, kümmerte sich mit um die Geschwister.
Der Patient konnte sich von sich aus nicht an den Unfall erinnern. Zu weit lag er zurück. In der Tanz- und Bewegungstherapie imponierte eine unterschiedlich ausgeprägte Bewegungsanomalie, die sich verstärkte, wenn Trauer und Abschied Thema waren, sich abschwächte, wenn er sich sichtlich wohler, getragener in der therapeutischen Beziehung fühlte. In der Tat hatte er viele teils sehr tragische Verluste und auch viel Leid in seinem Leben erlitten: Der Verlust der geliebten Großmutter an Krebs, als er 16 Jahre alt war. Sie war sehr qualvoll gestorben, weil es noch keine Therapeutika wie heute gab. Intensiv konnte er sich an den fauligen Geruch in ihrem Sterbezimmer erinnern. Der plötzliche Tod seiner jüngsten Schwester auf der Flucht, als diese ein halbes Jahr alt war. Die große Not und Angst der Mutter, als er selbst mit 7 Jahren an Diphtherie erkrankt gewesen war und fast gestorben wäre. Sein Herzinfarkt ein Jahr nach der Berentung.
Besonders vermisste er einen sehr guten Freund, der bei einem Motorradunfall tödlich verunglückt war, als der Patient gerade arbeitslos geworden war. Mit ihm wäre er so gerne weite Touren durch Europa gefahren, wie sie sie früher, als sie jung waren, unternommen und sich für die Zeit nach der beruflichen Tätigkeit vorgenommen hatten.
Der Patient hatte früh Entbehrungen hinnehmen müssen und nicht gelernt, auf eigene emotionale Bedürfnisse zu achten. Seine Mutter hatte nicht die Kraft, zu all ihrem eigenen Leid und die extremen Anforderungen an die Existenzabsicherung der Familie seine Bedürfnisse nach Zuneigung, Aufmerksamkeit, Zärtlichkeit ihres „Großen“ wahrzunehmen, ihm zu spiegeln und zu befriedigen. Er hatte daraus gelernt, sich ihrer Liebe zu versichern, indem er es ihr recht macht, sie unterstützte, ihr half und durch gute Leistungen in der Schule ihr keinen Kummer bereitete. So war es ihm gelungen, die Kontrolle zu behalten und seine Autonomie abzusichern.
Die Hüftschmerzen waren vielfältig körperlich untersucht worden. Es hatte sich nie ein somatisches Korrelat finden lassen, dass diese hinreichend hätten erklären können. Psychodynamisch stehen die erlebten Schmerzen für sein Bedürfnis nach Angenommen werden, nach Trost, nach emotionalem Rückhalt. Hierfür hatte er in seinem Leben keinen adäquaten Ausdruck gefunden, weil er selber es nicht anders gelernt hatte, als durch Schmerzen dieses Bedürfnis mitzuteilen.
Dieses Muster wiederholte er in der Arbeit und der Ehe. Er machte sehr bald erkennbar, dass er Verantwortung zu übernehmen bereit und imstande war, den Blick für das große Ganze hatte. Seine Leistungsbereitschaft war sehr hoch, den Blick auf die Uhr kannte er nicht. Er ordnete seine Bedürfnisse beruflichen Belangen unter und wurde hierin von seiner Freundin und späteren Frau unterstützt. Sie entstammte einem kleinen Unternehmerhaushalt und hatte verinnerlicht, das selbständig bedeutet: selbst und ständig in der Verantwortung für den Betrieb zu stehen. Sie unterbrach ihre berufliche Karriere mit der Geburt ihres ersten Kindes und hielt ihrem Mann den Rücken frei.
Als das jüngere Kind 12 Jahre alt war, suchte sie den Wiedereinstieg in den Beruf, fand sich auch schnell wieder zurecht und konnte eine gute Stellung erreichen, die ihr viel Befriedigung bedeutete. Als die jüngste Tochter 21 Jahre war und noch studierte, erkrankte seine Ehefrau an Brustkrebs. Auch wenn es ihr an den Lebensnerv ging, machte sie viel mit sich selbst aus, versuchte sie ihren Mann so weit wie möglich herauszuhalten, damit er sich seiner beruflichen Verantwortung widmen konnte.
Der Umbruch in einer Familie stellt die Eheleute vor eine besondere Herausforderung.
Oft werden die ausgezogenen Kinder jetzt erst richtig vermisst. Sie sitzen morgens nicht mehr mit am Tisch, sie bestimmen nicht mehr das alltägliche Gespräch der Eltern. Stritten diese sich zuvor über die Kinder, kommt es jetzt vermehrt zu Konflikten über das Zusammenleben als Mann und Frau. Bedürfnisse, die wegen der Kinder zurückgestellt worden waren, werden gerne wie selbstverständlich als zu befriedigen betrachtet, hatte doch jeder unausgesprochen die Erwartung oder zumindest die Hoffnung, dass der andere genauso empfindet.
Dass seine Kinder das Haus verlassen haben konnte der Patient nicht bewusst wahrhaben. Er hatte Angst, sie sich alleine zu überlassen, sie nicht weiter schützen zu können, wie es seinem Selbstverständnis entsprach. Lange hatten er, seine Frau und die Kinder gemeinsam Urlaub gemacht, länger als andere Gleichaltrige, die sich schon eher selbständig sich auf den Weg gemacht hatten. Er konnte erfassen, dass seine Kinder wohl mehr seine innere Bedürftigkeit nach familiärem Beisammensein erspürt hatten als sie ihm zugänglich war. Dass seine Frau es mit arrangiert hatte, dass er so für ihn spürbar einbezogen wurde. Er war sonst berufsbedingt selten im familiären Alltag anwesend.
Als Ergebnis der Therapie konnten die zentral wirksamen Analgetika bis auf eine Bedarfsdosis abgesetzt und eine geringe analgetische Basismedikation eingestellt werden. Eine kleine Erhaltungsdosis eines Antidepressivums wurde weiter verordnet. Die Antihypertensiva blieben bestehen, konnten den Druck jedoch besser auf ein normotones Niveau einstellen.
Die Bewegungsanomalien mit schmerzhaften schonhaltungsbedingten muskulären Verspannungen im Bereich des gesamten Bewegungsapparates hatten sich weit zurückgebildet. Niedrigfrequente regelmäßige Krankengymnastik reichte künftig aus.
Er war sich in der Therapie seiner Bedürfnisse nach Nähe, Körperlichkeit, Zuwendung deutlicher bewusst geworden und konnte diese in die Beziehung mit seiner Frau für sie verständlicher einbringen. Zärtliche Berührung und eine liebevolle Umarmung suchte er und konnte respektieren, wenn sie diese in einem Moment mal nicht zulassen konnte. Er fühlte sich nicht sogleich zurückgewiesen. Er stand nicht mehr unter dem Druck, dass sie jedes Mal sexuellen Verkehr miteinander haben mussten, wenn er ihre Nähe spüren wollte.
Er konnte sich mit ihr offen über seine Ängste vor Liebes- und Kontrollverlust austauschen. Wie er sich teilweise beschämt gefühlt hatte, ihr nicht nahe genug gewesen zu sein, als sie so schwer krank war. Es war seine Angst vor Nähe und drohendem Verlust gewesen, die ihn abgehalten hatte. Angst, dass sie seine Hilflosigkeit spüren könnte in einer Situation, wo er für sie stark sein wollte.
Sie konnte über ihr Gefühl von Verlassenheit und Überforderung zu ihm sprechen. Dass sie seine Unterstützung im Umgang mit den heranwachsenden Kindern gern mehr wahrgenommen hätte. Sie konnte ihm vorwerfen, dass sie sich gemeinsam viel zu sehr zurückgezogen und ihre Freunde vernachlässigt hätten.
Sie suchten gemeinsam nach Wegen, ihrem im Leben oft hintan gestellten Bedürfnis nach Lust Entsprechung zu verschaffen, gönnten sich bewusster kleine Highlights unter der Woche und eine größere Reise, die sie immer schon einmal hatten machen wollten. Sie trafen sich mit ihren Freunden, suchten vermehrt den Kontakt zu ihnen. Sie freuten sich gemeinsam über die Enkelkinder, die sie mehr in ihr Denken einbezogen aus dem Bedürfnis heraus, sie intensiver und bewusster erleben zu können in ihrem Heranwachsen.
Sie gaben sich auch vermehrt Raum für sich selbst, für ihre Hobbies, für ihre Interessen und Freunde. Sie klammerten sich weniger aneinander.
Nach einer intensiveren Phase der klinischen und später der ambulanten psychosomatischen Nachbehandlung wurde letztere niedrigfrequent fortgesetzt, um den gewachsenen vertrauensvollen Kontakt zwischen ihm und seinem Therapeuten aufrechtzuerhalten für den Fall, dass vorhersehbares Unvorhergesehenes passiert. Dessen Zeitpunkt man nicht kennt, von dem man lediglich weiß, dass es eintreffen wird. Das ihn überfordern könnte. Über das er sich dann vertrauensvoll mitteilen können möchte.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? In den nächsten Tagen folgt ein zweiter Teil dieses Artikels.
https://www.privatklinik-eschweiler.de/indikationen/chronische-schmerzen/
Weitere passende Beiträge
Wie können wir Ihnen helfen? Telefon 02403 – 78910 oder schreiben Sie uns eine Nachricht.




